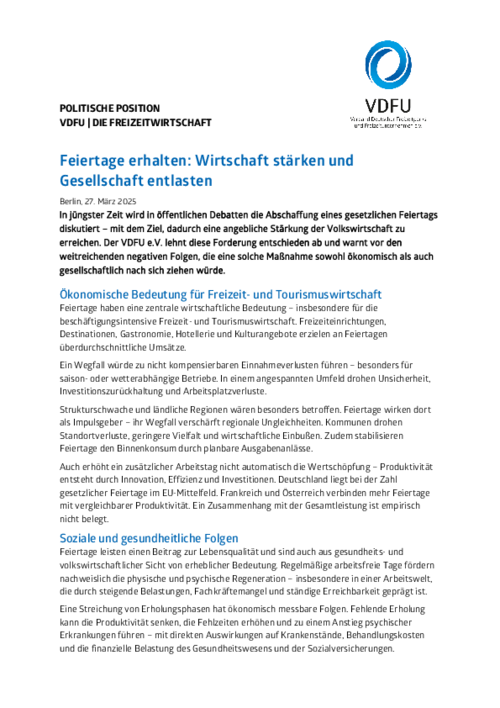Feiertage erhalten: Wirtschaft stärken und Gesellschaft entlasten
In jüngster Zeit wird in öffentlichen Debatten die Abschaffung eines gesetzlichen Feiertags diskutiert – mit dem Ziel, dadurch eine angebliche Stärkung der Volkswirtschaft zu erreichen. Der VDFU e.V. lehnt diese Forderung entschieden ab und warnt vor den weitreichenden negativen Folgen, die eine solche Maßnahme sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich nach sich ziehen würde.
Ökonomische Bedeutung für Freizeit- und Tourismuswirtschaft
Feiertage haben eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung – insbesondere für die beschäftigungsintensive Freizeit- und Tourismuswirtschaft. Freizeiteinrichtungen, Destinationen, Gastronomie, Hotellerie und Kulturangebote erzielen an Feiertagen überdurchschnittliche Umsätze.
Ein Wegfall würde zu nicht kompensierbaren Einnahmeverlusten führen – besonders für saison- oder wetterabhängige Betriebe. In einem angespannten Umfeld drohen Unsicherheit, Investitionszurückhaltung und Arbeitsplatzverluste.
Strukturschwache und ländliche Regionen wären besonders betroffen. Feiertage wirken dort als Impulsgeber – ihr Wegfall verschärft regionale Ungleichheiten. Kommunen drohen Standortverluste, geringere Vielfalt und wirtschaftliche Einbußen. Zudem stabilisieren Feiertage den Binnenkonsum durch planbare Ausgabenanlässe.
Auch erhöht ein zusätzlicher Arbeitstag nicht automatisch die Wertschöpfung – Produktivität entsteht durch Innovation, Effizienz und Investitionen. Deutschland liegt bei der Zahl gesetzlicher Feiertage im EU-Mittelfeld. Frankreich und Österreich verbinden mehr Feiertage mit vergleichbarer Produktivität. Ein Zusammenhang mit der Gesamtleistung ist empirisch nicht belegt.
Soziale und gesundheitliche Folgen
Feiertage leisten einen Beitrag zur Lebensqualität und sind auch aus gesundheits- und volkswirtschaftlicher Sicht von erheblicher Bedeutung. Regelmäßige arbeitsfreie Tage fördern nachweislich die physische und psychische Regeneration – insbesondere in einer Arbeitswelt, die durch steigende Belastungen, Fachkräftemangel und ständige Erreichbarkeit geprägt ist.
Eine Streichung von Erholungsphasen hat ökonomisch messbare Folgen. Fehlende Erholung kann die Produktivität senken, die Fehlzeiten erhöhen und zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen führen – mit direkten Auswirkungen auf Krankenstände, Behandlungskosten und die finanzielle Belastung des Gesundheitswesens und der Sozialversicherungen.
Feiertage tragen damit indirekt zur Stabilisierung und Entlastung öffentlicher Systeme bei. Ihre Reduzierung wäre wirtschaftlich kontraproduktiv und sozial riskant.
Gesellschaftliche Auswirkungen und politische Stabilität
In Zeiten multipler Krisen tragen arbeitsfreie Feiertage zur sozialen Balance bei. Sie bieten Menschen Raum für Erholung, Begegnung und kulturelle Teilhabe. Wer diese wenigen kollektiven Auszeiten streicht, riskiert eine weitere Entfremdung breiter Bevölkerungsschichten vom politischen System.
Nicht zuletzt trifft jede zusätzliche Einschränkung der Konsumentinnen und Konsumenten auf ein gesellschaftliches Klima, das von Preissteigerungen, Unsicherheit und wachsender Unzufriedenheit geprägt ist. Eine Streichung gesetzlicher Feiertage würde als Belastung wahrgenommen – und birgt das Risiko, radikalen politischen Strömungen weiteren Zulauf zu verschaffen. Es wäre ein strategischer Fehler.
Fazit
Wir appellieren nachdrücklich, von der Streichung eines gesetzlichen Feiertags Abstand zu nehmen. Die vermeintlichen wirtschaftlichen Vorteile sind kurzfristig gedacht und blenden die langfristigen Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit aus.
In einer Zeit großer Unsicherheit – geprägt von geopolitischen Konflikten, Klimawandel und tiefgreifenden Transformationsprozessen – braucht es Verlässlichkeit und Orientierung. Politische Debatten, die nicht zu Ende gedacht sind, dürfen bestehende Herausforderungen nicht zusätzlich verschärfen.
Die gesetzliche Regelung von Feiertagen fällt nicht zuletzt in die Zuständigkeit der Bundesländer. Eine bundesweite Umsetzung wäre verfassungsrechtlich wie politisch kaum realisierbar und würde das föderale Gleichgewicht zusätzlich belasten.